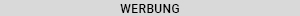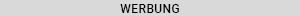Im Gespräch mit dem berühmten Basler Epidemiologen und Public Heatlh Experten Marcel Tanner
Der Basler Epidemiologe, Malariaforscher und Public Health-Experte Marcel Tanner ist ein Praktiker, ein «Menschenversteher» und ein Forscher durch und durch. Sein Einsatz in Krisengebieten hat ihn schon fast zu einer Ikone im Kampf gegen Epidemien gemacht. Tanners Fachkenntnis in seinem Kernkompetenzzentrum ist unbestritten. Die ruhige und dennoch dezidierte Art, wie er komplizierte Zusammenhänge erklärt, wird geschätzt. Und auch seine klare Haltung: Massnahmen gegen Pandemien müssen sein, aber der soziogesellschaftliche Aspekt darf dabei nie vergessen werden.

Marcel Tanner trat kürzlich aus der Corona-Taskforce zurück. Nach dem Rücktritt des Epidemiologen Christian Althaus kam es somit innerhalb kurzer Zeit zu einem weiteren prominenten Abgang. Althaus beklagte, dass die Wissenschaft vom Bundesrat zu wenig gehört werde. Marcel Tanners Gründe waren etwas anders gelagert: «Wir liefern der Politik die wissenschaftlichen Grundlagen und Handlungsoptionen. Dass nicht alles umgesetzt werden kann, liegt in der Natur und der Rolle der Taskforce», sagte er in einem Interview. Die sozialpolitische Umsetzbarkeit von Massnahmen müsse aber jeweils stets mit berücksichtigt werden. Der wahre Grund für den Task Force-Rücktritt war aber, dass er gleichzeitig Präsident der Akademien der Wissenschaften Schweiz sei und somit ein Doppelmandat entstand, was langfristig nicht zielführend gewesen sei. Wir haben mit dem prominenten Epidemiologen über seine Eindrücke der aktuellen Lage – aber auch über seine Heimat Basel – geredet.
Marcel Tanner, welche Gedanken beschäftigen Sie als «Praktiker» und weitgereister erfahrener Fachmann aktuell beim Thema Virologie und die Theorien sowie Mythen rund um die aktuelle Covid-Pandemie?
Marcel Tanner: Das ist eine breitgefächerte Frage. Erstens muss man anmerken, dass wir hier unterscheiden müssen zwischen wiederkehrenden oder neuen Erkrankungen. Wir wissen, dass wir zirka 1400 Infektionskrankheiten haben und ungefähr 800 davon sind auch im Tier vorhanden. Ergo ist also das Reservoir von Krankheiten vorhanden, welche vom Tier auf den Mensch überspringen können wenn der Mensch in den Lebensraum der Tiere eindringt. Ein typisches Beispiel dafür ist, wenn man abholzt und Menschen plötzlich in neue Gebiete vor stossen. Dies kennen wir auch von den SARS Infektionen, bei welchen Fledermäuse als Beute anderer Tiere eine Rolle spielen. Der Mensch jagt diese Tiere auch und isst sie. So werden diese Zyklen geschlossen und die Übertragung erfolgt auch auf Menschen. Das Potential mit all den möglichen Krankheitskeimen ist gross – das muss uns bewusst sein. Wir müssen nicht all diese Krankheiten und Keime genau kennen, aber wir sollten aufmerksam sein, wenn sich ein Lebensraum und ein Ökosystem verändert. Hier braucht es mehr Überwachung der Situation. Ausserdem leben wir in einer Umwelt mit einer hohen Diversität und die Beschäftigungen der Menschen ändern sich. Und somit auch ständig die Expositionsrisiken. Gute Epidemie- und Pandemievorsorge beginnt mit guten Überwachungsstrategien.
Sie haben viel gesehen und erlebt in den Jahrzehnten Ihres Schaffens. Sind die aktuellen disruptiven Entwicklungen aus Ihrer Sicht eine Steigerung oder einfach nur logische Folgen und «Phasen» in der Geschichte der Virologie beziehungsweise der Forschungsgeschichte?
Es ist eine Steigerung, da wir nicht nur Epidemien sondern eine Pandemie erleben. Aber es ist auch nicht erstaunlich, wenn wir das Potenzial der Infektionskrankheiten ansehen. Die SARS-Situation ist ein sehr gutes Beispiel. Bei SARS1 im Jahr 2003 hatten wir auch etwas völlig Unbekanntes und die Menschen sind gestorben an schweren Lungenerkrankungen. Es ist dann doch nicht so schlimm geworden wie befürchtet, weil das Virus SARS1, nicht wie jetzt SARS2, sehr viel schlechter übertragbar war von Mensch zu Mensch. Deswegen sind diese Herde, sehr schnell ausgestorben oder konnten durch Isolation eliminiert werden. Nun haben wir eine Epidemie, die zur Pandemie wurde. Eine Pandemie hat im übrigen nichts zu tun mit der Schwere einer Krankheit, sondern einzig dass das epidemische Geschehen die ganze Welt erfasst hat. Die Epidemie bezieht sich auf Infektion und nicht auf Erkrankungen, die gehäuft und über dem «Normalen», dem Durchschnitt auftreten.

Forschung ist der eine Aspekt im Kampf gegen Epidemien. Genau so wichtig ist die Analyse der Erkenntnisse.
Es behaupten Fachleute, dass die Covid-Pandemie einfach nur eine ist, die kommen musste, weil Pandemien ganz einfach nicht zu verhindern sind.
Ich denke Pandemien sind zu verhindern, wenn wir eben frühzeitig überwachen, frühzeitig dort eingrenzen, wo Übertragungen stattfinden. Was schwieriger ist, wenn sich ein Keim sich schnell von Menschen zu Menschen übertragen lässt. SARS1 ist hier wieder ein gutes Beispiel. Hätte SARS1 eine gute Ausbreitungskraft gehabt von Menschen zu Menschen, wären wir auch dort in eine Pandemie gelaufen. Entscheidend ist immer, dass wir frühzeitig Veränderungen, das Auftreten neuer Keime oder Mutanten feststellen können. Übrigens ein sehr wichtiger Ansatz auch bei der Problematik der zunehmenden antibakteriellen Resistenz.
Sind Sie der Meinung, dass ein früher, international koordinierter und effizienter Eingriff Covid hätte eingrenzen oder verlangsamen können?
Tatsache ist: wir lernen aus Situationen. Es ist sicher so, dass die meisten Länder auf dieser Welt, nicht sehr gut sind im Aufbau und Umsetzen von Überwachungssystemen, die zeitnahes Handeln ermöglichen. Es sind zu komplizierte Mechanismen, bei welchen wohl viele Daten gesammelt werden, aber nicht nur die wirklich nötigen. Und damit fehlen oft die zeitnahe Analyse und das gezielte Handeln. Auch spielen Aspekte wie die nationale Integrität oder Autonomie eine Rolle. Hingegen fordert die heute sehr hohe Mobilität der Menschen vor allem auch die internationale Zusammenarbeit. Fast alle Staaten hatten die Situation im Januar und Februar 2020 unterschätzt, aber viele hatten dennoch grundsätzlich richtig reagiert. Die «Zona Rossa» in Italien war eine gute Massnahme. Man hat jedoch nicht an die Ausbreitungskraft gedacht und wahrscheinlich diese Zonen zu klein gehalten. Die Chinesen haben Millionenstädte abgeriegelt und in Italien wurden einzelne Dörfer in der Lombardei abgesperrt. Das Konzept war richtig, aber nicht so einfach in Europa umsetzbar. In Neuseeland zum Beispiel war das alles verhältnismässig einfacher. Neuseeland ist eine Insel. Wir sitzen in der Schweiz auch auf einer Insel – aber mitten in Europa. Die internationale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen und gerade bei der Epidemie- und Pandemiebekämpfung muss künftig einfach viel besser funktionieren.
Wie war die Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Impfstoffe?
Tatsache ist, dass man sehr früh begonnen hat nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu forschen. Das hat man in früheren Zeiten, als es darum ging, Geld zu machen mit einem Impfstoff, weniger getan. Mittlerweile haben wir sechs verschiedene und wirksame Impfstoffe der ersten Generation, die zur Verfügung stehen, was in dieser Situation ein gutes Ergebnis ist. Was jetzt wichtig ist: Bei der Zweitgeneration der Impfstoffe müssen die Mutationen mit einbezogen werden. Da braucht es sicherlich eine verstärkte Zusammenarbeit. Bei der Herstellung des Impfstoffes hatte man nicht gedacht, dass die erste Generation so gut ist. Hier ist jetzt die Problematik der gerechten Verteilung gegeben. Wir wissen, dass der Impfstoff sicher und wirksam ist. Was wir jedoch noch nicht wissen ist: wie lange der Impfstoff wirkt. Wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass er mit Bestimmtheit für zwölf Monate schützt. Es braucht sicherlich weiterhin die Impfung als Teil der Massnahmenbündel. Vielleicht sogar eine Art «Boosting», eine Verstärkungsimpfung nach einem Jahr oder später.
Die Meinungen gehen weit auseinander bei diesem Thema. Sie haben ja auch schon skurrile Geschichten in Ihrem Schaffen erlebt…
Ja, in Tansania beispielsweise hat der Präsident gesagt, man habe viel gebetet und somit kein COVID. In einem Jahr hatte Tansania 570 Fälle vermeldet und 20 Todesfälle. Das hiess aber trotzdem nicht, dass es in Tansania kein COVID gibt. In meinem ganzen Arbeitsbekanntenkreis haben wir von vielen schweren Erkrankungen vernommen und auch sehr viele Menschen verloren, die gestorben sind, aber es wurde einfach nicht gemeldet.
Wie viel Respekt haben Sie vor weiteren Covid-Mutationen?
Die Mutationen gibt es immer und mittlerweile wurden Hunderte entdeckt. Nur sind nicht alle relevant, weil viele nicht so gefährlich sind. Hier geht es darum herauszufinden, wie sich eine Mutation verhält, sei es biologisch und pathologisch im Wirt. Gefahr besteht, wenn man Veränderungen feststellt. Veränderungen an diesem sogenannten Stachelprotein, im Fachjargon «Spike Protein». Das ist das, was man meiner Meinung nach den Menschen immer wieder zeigen muss. Nämlich, dass wir weiterhin mit diesem Virus leben müssen, wie wir uns schützen können und wie Herdenimmunität erreicht werden kann und muss.

Sie sind einst aus Basel in die Welt gezogen, um zu helfen, zu forschen… – was verbindet Sie noch mit der Region?
Ich bin im Breite Quartier aufgewachsen. Ich habe als Junge sehr viel lernen dürfen. Meine Grosseltern hatten im Baselbiet einen kleinen Bauernhof. Dort habe ich in den 50er Jahren bereits gespürt, dass man nur vorankommt, wenn man miteinander Probleme ist und so postiv aufeinander angewiesen ist. Heutzutage sind wir in einer Situation, wo jeder praktisch zur Wohnung raus kann und nicht beachten muss wer neben mir wohnt. Mein Grossvater hatte kein Pferd und keinen Traktor und deshalb mussten wir jeweils ausleihen. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre grassierte zudem in unserer Region die Maul- und Klauenseuche, da gab es auch Restriktionen in den Dörfern. Man durfte nicht einfach in den Stall des Nachbarn laufen, es hatte Desinfektionsschleusen und Restriktionen der Bewegung. Als Bube hat mich das beeindruckt und jetzt kommt das wieder zurück mit den Einschränkungen. Ich war lange Leiter des Schweizerischen Tropen- und Public Health Instituts. Es war eine Freude und ein Privileg, dieses zusammen mit den Mitarbeitern von einem Kleininstitut zu einer weltweit grossen Institution aufzubauen. Aus diesem Grund hiess meine Abschiedsvorlesung «No Roots, No Fruits». Wenn man nicht weiss wo man her kommt, weiss man nicht wo man hingeht. Da ich im Breite Quartier aufgewachsen bin, war ich viel am Rhein spazieren. Vor allem sonntags in der Sonntagsbekleidung mit meinem Vater zusammen und da hat es am Rhein diese Fischergalgen und ich hatte vor drei Jahren das Glück, dass ich nun so einen Fischergalgen erwerben durfte. Mit diesem hat sich jetzt auch der Kreis geschlossen, denn es ist wie ein Heimkommen.
Wie empfinden Sie die neuesten Lockerungen in der Region Nordwestschweiz?
Wichtig ist das Abwägen, was man machen muss in einer solchen Situation. Denn man muss den Menschen auch Perspektiven geben. Klar ist, dass das generelle Risiko für eine Infektion jetzt noch immer relativ hoch bleibt. Aber auf der anderen Seite ist die Lockerung gesellschaftlich auch ein Gewinn. Das soziale Gewebe und damit die Öffnungen tragen und prägen auch die Wirtschaft und selbstverständlich auch alle unsere Lebenswelten. Wichtig ist und bleibt, dass man die elementarsten Regeln gegen die Ansteckung, die Distanz und Hygiene weiter einhält. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch bald so wieder Konzerte gibt. Der «Public Health» Kontext ist wichtig, denn man sollte nicht Wirtschaft gegen Gesundheit abwägen. In einem Public Healthkontext gehören beide Aspekte zusammen. Meine Botschaft ist: In einer Krise fordert man nicht, in einer Krise arbeitet man zusammen. Ich will auch weitergeben, dass man nicht zu sehr den Kontrast zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik sehen darf. Wenn wir zudem alle ein bisschen bescheidener werden und erkennen, dass wir nur miteinander weiterkommen, jede und jeder einfach sein Wissen und Erfahrungen einbringt und wir miteinander lernen und damit Verbesserungen erzielen, dann wird alles sehr viel besser. Das habe ich vor allem in armen Ländern in Afrika und Asien lernen dürfen.
JoW, DaC